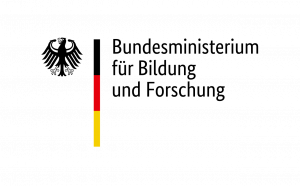Tumorentstehung
Krebszellen entwickeln sich aus normalen Körperzellen. Normalerweise werden Wachstum und Vermehrung von Zellen im Körper streng reguliert und fein abgestimmt. Krebszellen haben es geschafft, sich dieser Wachstumskontrolle zu entziehen. Sie vermehren sich ungebremst, wachsen in umliegendes Gewebe ein und zerstören es.
Grund dafür sind Veränderungen am Erbmaterial einer Zelle: Sogenannte Mutationen betreffen das genetische Material selbst, also die abzulesende Information zur Herstellung von Eiweißen. Möglich sind aber auch Fehler bei der Steuerung: Ob Erbinformationen überhaupt abgelesen werden oder nicht, bestimmen verschiedene Markierungen am Erbmaterial und an dessen Verpackungseiweißen – auch hier können Fehler zu unkontrolliertem Zellwachstum führen. Mehrere solcher Veränderungen sind notwendig, um eine Zelle zur Krebszelle werden zu lassen.
Die Ursachen sind vielfältig, oft wirken auch mehrere Faktoren zusammen (z.B. ererbte genetische Veränderungen, Infektionen, Chemikalien, persönlicher Lebensstil). Mutationen entstehen aber im Laufe des Lebens auch zufällig. Krebserkrankungen sind bei älteren Menschen häufiger als in jungen Jahren, da die Fähigkeit aufgetretene Fehler zu korrigieren im Alter abnimmt.
Darmkrebs
Den Begriff Darmkrebs benutzt man vor allem für Tumoren, die im Dickdarm oder Enddarm liegen. Krebs kann aber auch in allen anderen Darmabschnitten entstehen. Mehr als 95% aller Darmtumoren liegen allerdings im Dick- oder Enddarm.
Dick- und Enddarmkarzinome gehören zu den sogenannten soliden Tumoren: Diese Krebsarten gehen von Zellen eines einzelnen Organs aus. Zellen solider Tumoren können im Körper wandern, falls sie die Eigenschaft erlangen, sich aus ihrem Verband zu lösen und an anderen Stellen im Körper anzuwachsen. Dann bilden sich die sogenannten Fernmetastasen.
Bei den meisten Patienten gehen die Darmtumoren von den Drüsenzellen der Schleimhaut aus, die das Darminnere auskleidet. Diese Krebsarten werden auch als Adenokarzinome bezeichnet.
Risikofaktoren von Darmkrebs
Lebensgewohnheiten
An großen Bevölkerungsgruppen konnten Wissenschaftler mehrere Lebensstilfaktoren ausmachen, die das Darmkrebsrisiko beeinflussen. Dazu gehört unter anderem körperliche Aktivität. Bereits 30 bis 60 Minuten Bewegung täglich können das Risiko für Darmkrebs senken. Hierbei wird nicht zwischen Sport und anstrengender Alltagstätigkeit in Beruf oder Freizeit unterschieden.
Auch Übergewicht zählt zu den wichtigen Risikofaktoren für Darmkrebs: Menschen mit einem „Body Mass Index“ größer als 25 haben ein höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Die Erkrankungswahrscheinlichkeit nimmt weiter zu, je stärker das Übergewicht ist.
Der Konsum von Tabak steigert ebenfalls das Darmkrebsrisiko. Auch wenn der Zusammenhang mit dem Rauchen nicht so stark ist wie bei Lungenkrebs, reicht Fachleuten die aktuelle Studienlage jedoch aus, um auch zur Senkung des Darmkrebsrisikos den Verzicht auf Zigaretten und andere Tabakprodukte zu empfehlen.
Das Thema Ernährung hat durch widersprüchliche Studienergebnisse für viel Diskussion in der Fachwelt gesorgt. Dennoch ist man sich inzwischen bei einigen Ernährungsbestandteilen sicher, dass sie einen Effekt auf das Darmkrebsrisiko haben. Eine positive Wirkung hat beispielsweise eine ballaststoffreiche Ernährung ((Vollkorn-)Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, in geringem Umfang auch Gemüse und Obst). Einen negativen Effekt scheint ein hoher Konsum von rotem Fleisch (Rind, Schwein, Lamm) bzw. verarbeitetem Fleisch (z.B. Wurst) zu haben.
Vererbung
Von Darmkrebs ist bekannt, dass er familiär gehäuft auftreten kann: Beispielsweise erkranken Verwandte ersten Grades (Eltern, Geschwister, Kinder) von Darmkrebspatienten selbst häufiger an Darmkrebs als andere Menschen – ihr Risiko ist etwa zwei- bis dreifach erhöht. Finden sich weitere Hinweise auf eine Beteiligung von Risikogenen, kann die Erkrankungswahrscheinlichkeit auch höher liegen. Selbst bei entfernteren Verwandten lässt sich rein rechnerisch noch eine leichte Steigerung der Krebsrate ausmachen.
Auch ein gemeinsamer ungesunder Lebensstil in der Familie kann das Darmkrebsrisiko beeinflussen. Manchmal spielen wahrscheinlich beide Faktoren gemeinsam eine Rolle: Erbanlagen und Lebensstil. Das betrifft zum Beispiel genetische Veranlagungen, die zwar die Erkrankung nicht unmittelbar verursachen, aber empfindlicher für Risikofaktoren machen.
Das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren ist komplex – in den meisten Familien bleiben daher die tatsächlichen Ursachen unklar.
Das Alter zum Zeitpunkt der Diagnose gilt als einer der wichtigsten Hinweise auf veränderte Erbinformationen: Oft sind Patienten in betroffenen Familien jünger als der Durchschnitt der Darmkrebspatienten, manchmal sogar auffallend jung.
Träger solcher Gene können die ersten in ihrer Familie sein, wenn bei ihnen die Mutation zufällig („spontan“) aufgetreten ist.
Wohin gehen, wenn der Verdacht auf ein hohes familiäres Risiko besteht?
Dann besteht für betroffene Patienten wie für gesunde Verwandte die Möglichkeit einer genetischen Beratung. Der Hausarzt oder Facharzt kann eine entsprechende Überweisung ausstellen, viele Fachärzte für Gastroenterologie können erste Fragen auch direkt klären. Infrage kommen spezialisierte Arztpraxen für Humangenetik und auch die qualifizierten Zentren für die Beratung und Behandlung von Familien mit vererbbarem Krebsrisiko.
Verdauungsprobleme und andere Darmerkrankungen
Die meisten Verdauungsbeschwerden sind allerdings eher lästig als gefährlich. Verdauungsprobleme, die längere Zeit anhalten, sollten zur Sicherheit trotzdem durch den Arzt abgeklärt werden, denn: Änderungen von Stuhlgewohnheiten können ein Frühzeichen von Darmkrebs sein. Der Arzt kann am besten beurteilen, ob eine Änderung des Lebensstils sinnvoll ist – nicht wenige Verdauungsprobleme sind ein Hinweis darauf, dass es hier Verbesserungsbedarf geben könnte.
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED): Colitis ulcerosa und Morbus Crohn steigern das Darmkrebsrisiko
Ein gesteigertes Krebsrisiko ist bislang nur für zwei ernstere Darmerkrankungen sicher belegt: Bei Colitis ulcerosa handelt es sich um eine chronische Entzündung des Dickdarms, die heute bei entsprechender Behandlung gelindert werden kann. Die Erkrankung ist aber nicht dauerhaft heilbar. Als Morbus Crohn bezeichnet man eine ähnliche entzündliche Erkrankung. Sie betrifft bei den meisten Patienten den letzten Dünndarmabschnitt. Ein Befall des Dickdarms ist möglich, aber seltener.
Betroffene mit Colitis ulcerosa leben mit einem höheren Risiko für ein Kolonkarzinom. Die Risikosteigerung ist abhängig vom Ausmaß der chronischen Entzündung und von der Dauer der Erkrankung. Auch Patienten mit Morbus Crohn haben möglicherweise ein höheres Risiko für Dickdarmkrebs als gesunde Menschen. Dies gilt insbesondere, wenn die Entzündung den Dickdarm befallen hat. Allerdings gibt es zur Erkrankungswahrscheinlichkeit noch keine verlässlichen Angaben.
Zahlen und Statistiken zu Darmkrebs
In Deutschland erkrankten 2016 rund 25.990 Frauen und 32.300 Männer erstmals an Dickdarmkrebs. Im Jahr 2020 werden laut Schätzung der deutschen epidemiologischen Krebsregister und des Zentrums für Krebsregisterdaten im Robert-Koch-Institut 31.300 Männer und 24.100 Frauen an einem kolorektalen Karzinom erkranken.
Damit ist Darmkrebs derzeit bei Männern die dritthäufigste und bei Frauen die zweithäufigste Tumorerkrankung hierzulande. Deutschland liegt bei den Neuerkrankungsraten im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Fachleute machen dafür unter anderem die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten verantwortlich.
Vermutlich durch eine verbesserte Darmkrebsfrüherkennung gehen die Zahl der Neuerkrankungen seit 2003 leicht zurück. Zur Klärung sind allerdings weitere Studien notwendig. Im europäischen Vergleich ist die Neuerkrankungsrate am stärksten in den Ländern gesunken, in denen Krebsfrüherkennungsangebote bestehen, insbesondere die Möglichkeit der Darmspiegelung.

Bitte beachten Sie. Hierbei handelt es sich nicht um die Studienzentrale der NETZ-Studie.